So funktioniert ein Kernkraftwerk
Im nuklearen Teil eines Atomkraftwerks entsteht durch Kernspaltung Wärme. Diese Wärme wird im konventionellen Teil mit Dampfturbinen in elektrischen Strom umgewandelt, ähnlich wie bei fossilen Kraftwerken.

Wärmeerzeugung im Nuklearteil
Im Nuklearteil befindet sich der Reaktorkern. Er befindet sich in einem dickwandigen Reaktordruckbehälter aus Stahl und besteht aus mehreren Metern langen Brennelementen. Die Brennelemente bestehen wiederum aus Bündeln dünner Brennstäbe. In ihnen befindet sich der Kernbrennstoff in Form kleiner, uranhaltiger Pellets. In den luftdicht verschlossenen Brennstäben läuft die Kernspaltung ab, bei der Wärme entsteht.
Die Kernkraftwerke in der Schweiz sind mit Leichtwasserreaktoren ausgerüstet. In den Leichtwasserreaktoren dient das Wasser einerseits es als Kühlmittel und transportiert die Energie aus dem Reaktor zu den Dampfturbinen. Andererseits bremst es die bei der Kernspaltung frei werdenden Neutronen ab (elektrisch neutrale Bausteine des Atomkerns) und wirkt so als Moderator. Nur wenn sie gebremst werden, können die Neutronen weitere Kernspaltungen auslösen (Kettenreaktion). Fehlt im Leichtwasserreaktor das Wasser, werden die Neutronen nicht mehr abgebremst und die Kettenreaktion hört auf. Es gibt zwei Varianten von Leichtwasserreaktoren: Druckwasserreaktoren und Siedewasserreaktoren. In der Schweiz sind beide Varianten vertreten.
Funktionsweise Druckwasserreaktor
Bei den Druckwasserreaktoren (Beznau-1, Beznau-2 und Gösgen) wird im Reaktor das Wasser unter hohem Druck erhitzt, ohne dass es zu sieden beginnt. Das erhitzte Wasser wird zu Dampferzeugern ausserhalb des Reaktors geleitet, wo es seine Wärme an einen weiteren Wasserkreislauf abgibt. Das Wasser im zweiten Kreislauf erhitzt sich und verdampft. Dieser Dampf treibt die Turbinen im konventionellen Teil des Kernkraftwerks an.
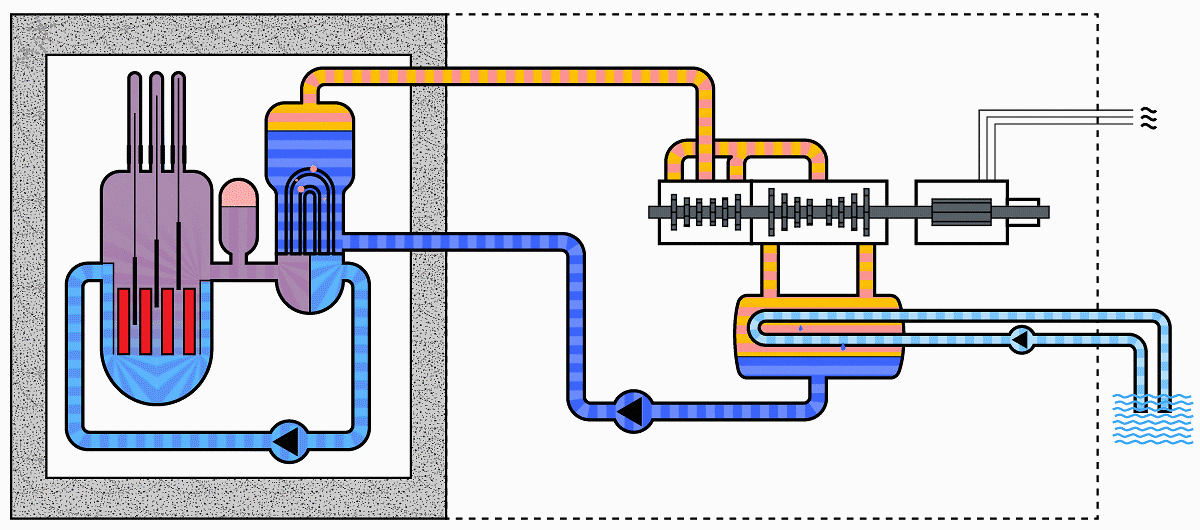
Funktionsweise Siedewasserreaktor
Bei den Siedewasserreaktoren (Leibstadt) wird der Dampf im Reaktordruckbehälter erzeugt und direkt zu den Turbinen geleitet. Anders als bei den Druckwasserreaktoren enthält der zu den Turbinen gelangende Dampf Spuren kurzlebiger radioaktiver Stoffe.
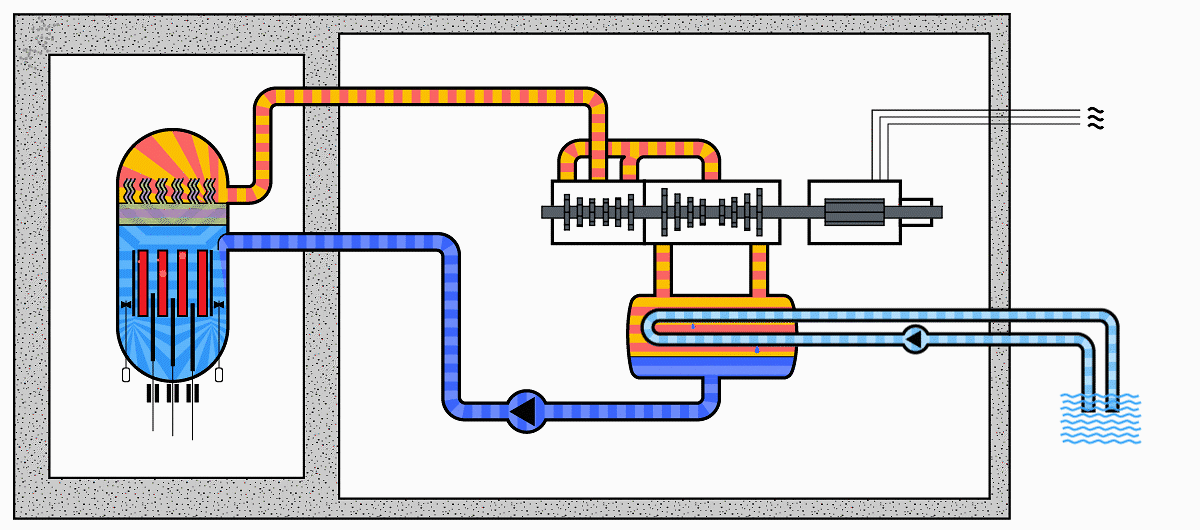
Stromproduktion im konventionellen Teil
Im Maschinenhaus des konventionellen Anlagenteils stehen die Dampfturbinen und die Generatoren. Der heisse Dampf treibt die Turbinen an, die wiederum den Generator antreiben, der die Bewegungsenergie in Strom umwandelt.
Kühlung der Dampfturbine
Damit die Dampfturbinen die Wärme des zugeführten Dampfes in eine mechanische Bewegung umwandeln können, müssen die Temperatur- und Druckunterschiede vor und nach der Turbine möglichst gross sein. Deshalb wird der Dampf nach dem Austritt aus der Turbine über einen weiteren Wasserkreislauf so weit abgekühlt, dass er wieder zu flüssigem Wasser kondensiert. Eine Pumpe befördert dieses Wasser aus dem Kondensator zurück in den Dampferzeuger (Druckwasserreaktor) bzw. in das Reaktordruckgefäss (Siedewasserreaktor). Dort wird es erneut aufgeheizt und gelangt als Dampf wieder zu den Turbinen. Direkte Kühlung mit Flusswasser
Das Wasser für die Kühlung des Dampfs beim Turbinenaustritt entnehmen die Kernkraftwerke Beznau-1 und Beznau-2 der Aare und leiten es leicht erwärmt in den Fluss zurück. Verbindliche Grenzwerte schützen die Aare vor übermässiger Erwärmung. Dieser Wasserkreislauf ist vom Reaktor vollständig getrennt und enthält keine radioaktiven Stoffe.

Kühlung mit einem Kühlturm
In den Kernkraftwerken Gösgen und Leibstadt wird der Kondensator mit Wasser gekühlt, das in einem Kreislauf vom Kraftwerk zum Kühlturm und wieder zurück fliesst. Im Kühlturm wird das im Kraftwerk erwärmte Wasser verrieselt. Dabei geben die herunterfallenden Wassertröpfchen Wärme an den Luftzug im Kühlturm ab (Kamineffekt). Ein kleiner Teil des Wassers verdunstet und wird beim Austritt oben aus dem Turm als Nebelfahne sichtbar. Sie besteht also aus reinen Wassertröpfchen und ist für die Umwelt unbedenklich. Der verdunstete Wasseranteil wird durch Flusswasser ersetzt. Auch dieser Wasserkreislauf ist vom Reaktor vollständig getrennt und enthält keine radioaktiven Stoffe.
Fernwärme
Der Wirkungsgrad der Kernkraftwerke kann durch die konsequente Nutzung der Abwärme verbessert werden. Die Abwärme von Kernkraftwerken kann weiter genutzt werden. So liefert das Kernkraftwerk Beznau über das Fernwärmenetz Refuna für gut über 2000 Anschlüsse in Industrie, Gewerbe, öffentlichen Bauten und Privathaushalten mit CO₂-freier Wärme. Auch das Kernkraftwerk Gösgen liefert Prozesswärme für zwei Papierfabriken. Mit den so jedes Jahr eingesparten 20’000 Tonnen Heizöl werden jährlich über 60’000 Tonnen CO₂ vermieden.