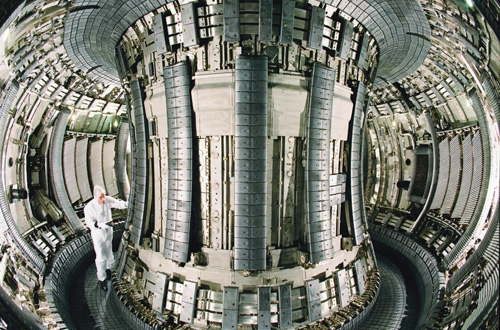Doch sie wirft gesellschaftliche Fragen auf wie die Finanzierung angesichts knapper öffentlicher Mittel oder die Folgen eines grosstechnischen Einsatzes für Mensch und Umwelt. 2001 beauftragte der Deutsche Bundestag das Institut für Technologiefolgenabschätzung (Itas) des Forschungszentrums Karlsruhe, diesen Fragen nachzugehen.
Ein jetzt erschienener Erfahrungsbericht fasst die Hauptergebnisse der Studie und der nachfolgenden Debatte im Bundestagsplenum zusammen. Demnach dürften weltweit noch EUR 60-80 Mrd. nötig sein, um die industrielle Reife der Fusionstechnologie zu erreichen. Begründet würde diese Investition mit Vorsorgeüberlegungen, nachdem dem weltweit wachsenden Energiebedarf endliche fossile Ressourcen und der Klimaschutz entgegenstünden. Bis in 50 Jahren könnten Fusionskraftwerke besonders die Grundlast in urbanen Regionen decken. Ob sie dafür ausreichend sicher zu bauen sind, hängt laut der Studie noch von einer über Jahrzehnte zu leistenden Entwicklungsarbeit ab. Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit sei beim heutigen Stand ebenfalls recht spekulativ. Aus Umweltsicht habe die Fusion den unbestrittenen Vorteil, keine Klima schädigenden Gase freizusetzen, die Ressourcensituation sei unproblematisch und die Versorgung erfordere nur wenige Transporte. Hingegen stellten radioaktive Abfälle sowie der Brennstoff Tritium radiologische Risiken dar. Zusammenfassend sei es heute noch nicht klar, wie weit die Fusion die vielen Facetten des Nachhaltigkeitspostulats erfüllen könne. Jetzt schon entsprechende Forderungen zu formulieren und die Entwicklung daran zu orientieren, sei umso wichtiger. Sicherlich würde die Erschliessung einer praktisch unerschöpflichen, universell verfügbaren Energiequelle zur Konfliktvermeidung beitragen. Trotzdem könnten Fusionskraftwerke als zentrale Grossanlagen auf Akzeptanzprobleme stossen. Ein frühzeitiger Dialog zwischen Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit sei daher anzustreben.
Quelle
P.B. nach Nachrichten des Forschungszentrums Karlsruhe, Jg. 36, Nr. 4/2004